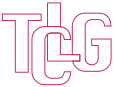Nächste Meldung · Vorige Meldung · Zur Übersicht
24.09.2006
Berliner Manifest des Bundesverbandes Lebensrecht (BVL)
Erklärung des Bundesverband Lebensrecht anlässlich der Aktion "1000 Kreuze für das Leben" am 23. September 2006 in Berlin im Wortlaut, verabschiedet von der Mitgliederversammlung des Bundesverbands
Der Bundesverband Lebensrecht (BVL), ein Zusammenschluss von zwölf Lebensrechtsorganisationen in Deutschland mit Sitz in Berlin, appelliert an den für die Gesetzgebung verantwortlichen Bundestag, endlich Mut zur Wahrheit über die Praxis der jährlich hunderttausendfachen Tötung ungeborener Kinder zu zeigen.
Vor nunmehr elf Jahren trat das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz in Kraft, mit dem das erklärte Ziel verfolgt werden sollte, das Leben ungeborener Kinder besser als zuvor zu schützen. Weder die Bundesregierung noch der verantwortliche Gesetzgeber haben bisher danach gefragt, ob dieses Ziel erreicht worden ist.
Bei sonst jedem Gesetz folgt nach seinem Inkrafttreten stets die Prüfung, ob es in der Praxis „greift“, der mit ihm verfolgte Zweck auch erreicht wird. Für ein Gesetz, das dem Schutz menschlichen Lebens dienen soll, muss das erst recht gelten. Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht dem Bundesgesetzgeber bezüglich der Gesetze zum „Schwangerschaftsabbruch“ auch ausdrücklich eine Beobachtungspflicht auferlegt. In angemessenen zeitlichen Abständen ist er verpflichtet zu prüfen, ob die von ihm erlassenen Gesetze die erhoffte Schutz-wirkung für das Leben Ungeborener tatsächlich entfalten oder ob sich Mängel des gesetzlichen Konzepts oder seiner praktischen Durchführung offenbaren. Dieser Pflicht ist der Bundesgesetzgeber bisher zu keiner Zeit nachgekommen.
Das erklärte Ziel eines besseren Lebensschutzes Ungeborener ist offenkundig verfehlt worden. Obwohl die Zahl der Frauen im gebärfähigen Alter und die der Geburten in den letzten zehn Jahren stetig gesunken sind, hat sich die statistisch ausgewiesene Gesamtzahl der Abtreibungen in Deutschland während dieses Zeitraums nicht nennenswert verringert. Die tatsächliche Gesamtzahl liegt mit Sicherheit deutlich höher. Die Abtreibungshäufigkeit jedenfalls nimmt in Deutschland ständig zu. Infolge der geltenden Gesetze und ihrer Praxis ist das Unrechtsbe-wusstsein für die Tötung ungeborener Kinder weithin geschwunden. Die Beratungs-praxis offenbart bei näherem Hinsehen deutliche Mängel.
Der Bundesverband Lebensrecht fordert den Bundesgesetzgeber deshalb erneut dazu auf, seiner Beobachtungspflicht bezüglich der Auswirkungen der Abtreibungsgesetze endlich nachzukommen. Diese Beobachtungspflicht darf nicht auf die Praxis der Spätabtreibungen beschränkt gesehen werden.
Vordringlicher Korrekturbedarf besteht bezüglich der Spätabtreibungen. Solche Kindestötungen erfolgen in einem Stadium der Schwangerschaft, in dem das ungeborene Kind (ab etwa der 22. Woche) bereits außerhalb des Mutterleibes lebensfähig ist. Der Grund für die Tötung ist in aller Regel die nach einer Pränataldiagnose zu erwartende Behinderung des Kindes. ./.
Die Tötung ungeborener Kinder mit diagnostizierter Behinderung ist nach geltendem Gesetz während der gesamten Dauer der Schwangerschaft möglich. Grund hierfür ist die weite Fassung der sozial-medizinischen Indikation (§ 218a Absatz 2 StGB), durch die nach dem Willen des Gesetzgebers die frühere embryopathische Indikation, welche die Tötung ungeborener Kinder wegen ihrer Behinderung erlaubte, „aufgefan- gen“ werden soll.
Mit namhaften Verfassungsrechtlern ist der Bundesverband Lebensrecht der Auffassung, dass § 218a Absatz 2 StGB, soweit er die Tötung ungeborener Kinder wegen ihrer zu erwartenden Behinderung als „nicht rechtswidrig“ ermöglicht, gegen das Diskriminierungsverbot (Artikel 3 Absatz 3 Satz 2 GG: „Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“) verstößt. Um diesem Verbot zu entsprechen, muss die weite sozial-medizinische Indikation durch Gesetzesänderung wieder auf eine rein medizinische zurückgeführt werden mit der Folge, dass embryopathisch begründete Spätabtreibungen nur noch bei Gefahr für das Leben der Mutter möglich sind. Die stattdessen bisher gemachten Vorschläge zur Verhinderung von Spätabtreibungen berühren nicht den Kern des Problems. Sie lassen bestenfalls eine Verbesserung der beste-henden Zustands erhoffen.
Mit einer psychosozialen Beratung vor einer Pränataldiagnostik könnte erreicht werden, dass diese nicht mehr im Regelfall erfolgt, sondern auf begründete Ausnahmefälle beschränkt bleibt. Eine solche Beratung könnte dem „Recht auf Nichtwissenwollen“ dienen und den Eltern das Risiko einer Pränataldiagnostik vor Augen führen.
Ein verstärktes Angebot einer psycho-sozialen Beratung nach Vorliegen eines embryopathischen Befundes wäre hilfreich, insbesondere um den Eltern zu helfen, sich auf das Leben mit einem behinderten Kind einzustellen (z. B. bei Downsyndrom).
Eine solche Beratung zur Pflicht zu machen, erscheint dagegen verfehlt und ist deshalb abzulehnen.
In den Fällen der sozial-medizinischen Indikation muss der Schwangerschaftsab-bruch „nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt“ sein. Dennoch hat sich die Praxis bei Vorliegen eines embryopathischen Befundes längst zu einer Tötung des Ungebore-nen auf Wunsch der Schwangeren entwickelt. Diese mit dem Gesetz nicht zu vereinbarende Tendenz würde durch eine psycho-soziale Pflichtberatung bei embryopathischen Befund noch zusätzlich gefördert. Durch eine Ausdehnung des „Beratungskonzepts“ auf solche Fälle würde dieses Konzept zudem - möglicherweise gewollt - verfestigt, noch ehe es einer Prüfung auf seine Wirksamkeit unterzogen worden ist. Ein weiteres Bedenken kommt hinzu: Eine Pflichtberatung in Fällen eines embryopathischen Befundes wäre zwangsläufig eine weitere Voraussetzung dafür, dass ein nachfolgender Schwangerschaftsabbruch nach dem Gesetz „nicht rechtswidrig“ ist. Die Bescheinigung einer solchen Pflichtberatung wäre unbestreitbar ein Erlaubnisschein und die Mitwirkung an der Pflichtberatung erst recht eine solche an der Tötung des Kindes.
Eine Beschränkung der Arzthaftung auf Fälle grober Fahrlässigkeit könnte die Gefahr mindern, dass Schwangerschaftsabbrüche zur Vermeidung eines Haftungs-risikos auf Verdacht hin erfolgen.
Nächste Meldung · Vorige Meldung · Zur Übersicht
Die Meldungen sind teilweise Pressemitteilungen und Newslettern von Partnerorganisationen entnommen. Das Meldungs-Datum bezeichnet den Tag der Aufnahme auf diese Webseite.